"Die Schlacht von Sievershausen und die Legende von der Ermordung Moritz von Sachsen durch Georg von Karras"
von Olaf Knoll
Im Winter 1552 sandte Kurfürst Moritz Vollradt von Mansfeld, der zu diesem Zeitpunkt immer noch im Dienste des Französischen Königs Heinrich II. war, nach Frankreich, um den Vertrag – als Defensivbund 1551 geschlossen – zu bekräftigen und die von Moritz an Heinrich II. zugesagten Truppen von 4.000 Mann zu Pferde und 12.000 zu Fuß nach den Niederlanden zu führen.
Moritz war sehr wohl entschlossen diesen Kriegszug in die Niederlande anzuführen, er hatte bereits veranlasst, dass Leute ausgesandt wurden, um den Weg zu untersuchen, insbesondere Furten und Pässe festzulegen, die im Voraus einzunehmen waren. Zuvor musste er aber die durch Markgraf Albrecht Alcibiades im 2. Markgrafenkrieg verursachten Unruhen im Reich beenden und ihn auf seinem Weg ins Braunschweigische stellen.
Das von Moritz angeführte bundesdeutsche Heer erhielt Unterstützung von Ferdinand I., den fränkischen Bischöfen und Heinrich von Braunschweig, die als die größten Verfolger der Protestanten im Deutschen Reich galten. Sehr verwunderlich, wenn Ferdinand I., Bruder Karl V., den Kurfürsten mit Kriegsvolk unterstützte, Albrecht Alcibiades aber den Segen des Kaisers erhielt, obwohl er die Evangelischen in Niederdeutschland in Schutz nahm und offensichtlich „nach einer popular-protestantischen Macht trachtete“. Sicherlich verfolgte der Kaiser mit dieser Unterstützung Albrechts das Ziel einer Anarchie im Reich und der gegenseitigen Schwächung der Fürsten.
Der moralische Vorteil von Moritz war allerdings, dass er entgegen der Position des Markgrafen – der raubend und brandschatzend das Land verwüstete - den Landfrieden und den bestehenden Besitz verteidigte. Albrecht verfocht Ansprüche, die er mit Gewalt erworben hatte und somit vor keinem Gerichtshofe zu Recht bestehen und auch nicht durch die Einwilligung des Kaisers eine Rechtsgrundlage erhalten konnten. Wenn der Kurfürst siegte, so war das Ansehen des Kaisers im Reich vollends vernichtet. Wenn es dann noch zu dem besprochenen Unternehmen gegen die Niederlande gekommen wäre, so wäre die Grundlage seiner Macht absolut erschüttert worden. Schlug allerdings Albrecht Alcibiades Moritz aus dem Felde, so hätte ein Sturm auf alle Bistümer eingesetzt, alle in den letzten Kriegen erworbenen Besitztümer wären in Frage gestellt worden und alle Feinde des Kurfürsten Moritz hätten sich gegen ihn erhoben.
Unter diesen Gegebenheiten rückten die Kriegsgegner im Juli 1553 widereinander. Zuvor musterte Moritz seine thüringische und meißnische Ritterschaft zu Halle, Merseburg und Sangerhausen - sehr wahrscheinlich befand sich unter den meißnischen Rittern auch Georg von Karras, ein angesehener Lehensherr, dessen Haupteinflussgebiet im Elbtal zwischen Meißen und Dresden lag -, um sich dann in Sangerhausen zu sammeln und anschließend ihren Weg nach dem Eichsfeld zu nehmen. Erst in Gieboldehausen stießen die fränkischen und in Einbeck die braunschweigischen Scharen zu dem bundesdeutschen Heer, das nun über achttausend Mann zu Fuß und achteinhalbtausend Reisige (Ritter) verfügte, eingeschlossen tausend böhmische Reiter, die Heinrich von Plauen im Auftrag Ferdinand I. heranführte.
Markgraf Albrecht Alcibiades befand sich vor „dem festen Hause Petershagen“, an der Weser, nördlich von Minden, gelegen. Da er überzeugt war, dass er dem kurfürstlichen Heer nicht gewachsen war, denn nur mit seinem Fußvolk sah er sich seinem Feinde gegenüber ebenbürtig, seine Reiterei mit nur dreitausend Mann war deutlich in der Unterzahl. Aus diesem Grund fasste er den Entschluss Moritz an günstiger Stelle in seinem Rücken auszuweichen und sich durch das Stift Magdeburg auf das Kurfürstentum Sachsen zu stürzen.
Diese Gefahr erkennend, veranlasste Moritz die Furt in der Nähe von Sievershausen zu sichern, die Albrecht nehmen musste, um nach dem Magdeburgischen zu gelangen. In einem seiner Briefe heißt es hierzu „er muss weichen oder er muss schlagen“. Moritz war voller „Schlachtbegier“, die ihn immer ergriff, wenn der Feind sich näherte. Er wurde mit einem Kriegsross verglichen, das nicht mehr zu halten war, wenn er das wiehern der feindlichen Pferde gehört hat.
Dies war auch der Grund, weshalb Moritz den Beschluss des Kriegsrates missachtend, die günstige Stellung aufgab, die man eingenommen hatte, um den Feind zu stellen, und sich diesem entgegenwarf. Mühelos warf er eine Abteilung des markgräflichen Fußvolkes über den Haufen. Dies verschaffte Albrecht Alcibiades einen Vorteil, weil durch das Vorpreschen von Moritz die kurfürstliche Schlachtordnung gestört wurde. Nun rückte der Markgraf vor und drang in die kurfürstliche Reiterei ein, durch aufgewirbelten Staub unterstützt, der den Reitern in die Augen trieb. So konnte er die Furt, an der ihm sehr gelegen war, einnehmen. Nun stürzten sich der Kurfürst und Herzog Heinrich mit den besten Rittern unter den Hoffahnen von Braunschweig und Sachsen auf den markgräflichen Haufen, so
kam es an dem engen Ort zu einem stürmischen Zusammentreffen, in dem mit viel Erfolg Büchsen und Pistolen zum Einsatz kamen. Manch einer wusste nicht, ob er Feind oder Freund getroffen hat.
„In dem wilden Getümmel des Reitergemenges – man wusste nicht, ob nicht gar aus einem Rohr seiner eigenen Leute – war Kurfürst Moritz von einer Kugel getroffen worden“.
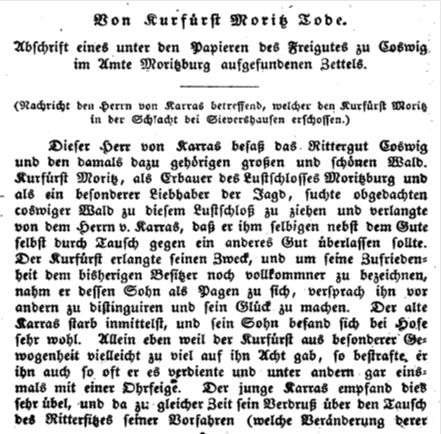 Kopie aus Böttchers Geschichte des Kurstaates und Königreichs Sachsen, Band 1
Kopie aus Böttchers Geschichte des Kurstaates und Königreichs Sachsen, Band 1
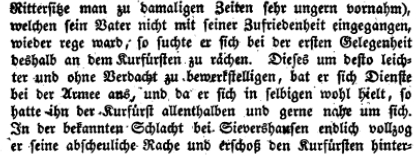
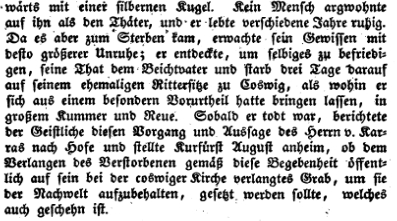
Was weist heute noch neben der Kirche in Coswig, eine der schönsten alten Dorfkirchen Sachsens, auf die Familie der von Karras hin? Das ist der Standort der ehemaligen Wasserburg, die sich nordöstlich der Kirche befand und heute von einer Villa aus dem 19. Jahrhundert überbaut wurde, in der sich seit 1996 das Karrasburgmuseum Coswig befindet.
Olaf Knoll
Literatur:
Dr. Friedrich Albert von Langenn: Moritz herzog und kurfürst zu Sachsen, Eine Darstellung aus dem Zeitalter der Reformation, 1841
C.W. Böttiger: Geschichte des Kurstaates und Königreich Sachsen, Band 1, Hamburg 1830
Karl Lamprecht: Deutsche Geschichte, Zweite Abteilung, Neuere Zeit, Erster Band, Zweite Hälfte, Gesammelte Werke Bd. 5.2., Berlin 1912
Rankes Meisterwerke: Deutsche Geschichte im Zeitalter der Reformation, 5. Band, München und Leipzig 1914
Johann Georg Theodor Grässe: Der Sagenschatz des Königreichs Sachsen, Dresden, 1855
H.E. Schwarze: Vollständige Jubelakten des Religion-Friedens, Leipzig 1756, 8. Teil S.779
